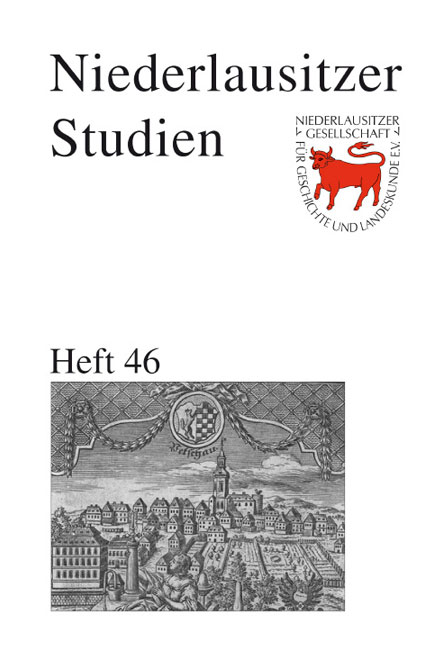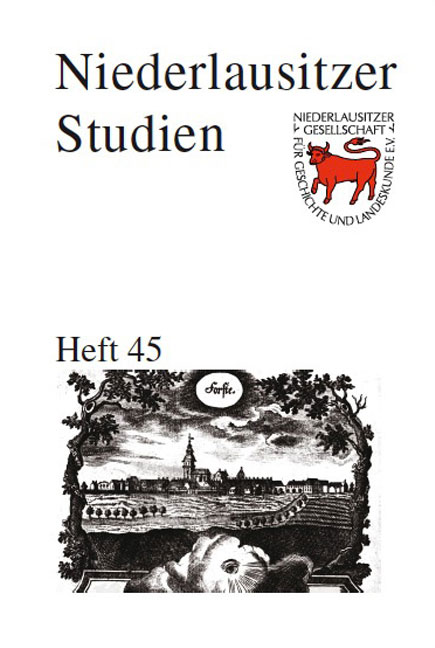Niederlausitzer Gesellschaft
für Geschichte und Landeskunde e.V.
Wir begrüßen Sie auf unserer Webseite und freunen uns über Ihr Interesse für die Geschichte der Niederlausitz.
Im April 1990 wurde in Cottbus die Niederlausitzer Gesellschaft für Geschichte und Landeskunde (wieder) begründet. Sie sieht sich als Nachfolger der am 3. Juni 1884 gebildeten Niederlausitzer Gesellschaft für Anthropologie und Urgeschichte. Deren erster Vorsitzende war der damalige Calauer Kreisarzt Dr. Siehe. Der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit lag zunächst auf Urgeschichte und Volkskunde. Sehr bald erfolgte jedoch eine Ausweitung, insbesondere auf Landesgeschichte, Dialektforschung und Namenkunde.
Aktuelles
Publikationen
»Niederlausitzer Studien«
Die »Niederlausitzer Gesellschaft für Geschichte und Landeskunde e. V.« gibt die »Niederlausitzer Studien« heraus. Diese werden vom Regia-Verlag in Cottbus vertrieben.